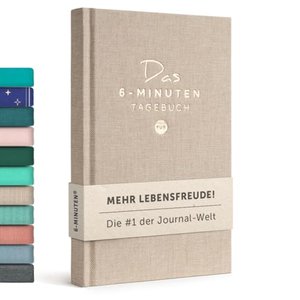Kennst du das? Dein Chef lobt dich für ein Projekt, Kolleginnen bedanken sich für deine Hilfe, und du bekommst sogar ein kleines Dankeschön. Doch dann kommt eine kleine Kritik – und genau die bleibt dir den ganzen Abend im Kopf. Du erinnerst dich noch genau an den peinlichen Moment vor drei Jahren, aber das Kompliment von letzter Woche? Völlig verschwunden. Das ist kein Zufall! Unser Gehirn hat eine besondere Vorliebe für negative Erlebnisse – und das hat sehr gute Gründe.
Willkommen beim sogenannten Negativitätsbias! Forscher*innen bestätigen, dass unser Gehirn tatsächlich stärker auf negative Reize reagiert als auf positive oder neutrale. Aber warum ist das so? Wir haben die faszinierenden Gründe für dich zusammengefasst.
#1
Überlebensvorteil aus der Steinzeit
Der Negativitätsbias ist evolutionär bedingt und war für unsere Vorfahren überlebenswichtig. Während es schön war, eine essbare Beere zu finden, war es lebensentscheidend, sich an die giftige Pflanze oder den gefährlichen Säbelzahntiger zu erinnern. Pionier auf dem Gebiet und Begründer des Bereichs der sozialen Neurowissenschaften, Prof. John T. Cacioppo erklärte das Phänomen so: Wer besser auf mögliche Gefahren achtete, überlebte länger – und gab diese Eigenschaft an uns weiter. Die Gehirnstruktur hat sich also allmählich angepasst, um negativen Informationen mehr Beachtung zu schenken. Heute reagieren wir immer noch so, auch wenn die „Gefahr“ nur eine unangenehme E-Mail ist.
#2
Die„Angstzentrale“ läuft auf Hochtouren
Studien mit funktioneller Magnetresonanztomografie zeigen: Werden wir mit negativen Bildern konfrontiert, steigt die Aktivität in der Amygdala – unserer „Angstzentrale“ im Gehirn. Die Amygdala ist für die emotionale Bewertung und Verarbeitung zuständig, während der Hippocampus als Schaltstelle fungiert und Dinge vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis überträgt. Bei emotionalen Ereignissen ausgeschüttete Botenstoffe, insbesondere Noradrenalin und Cortisol, fördern die Neubildung und Stärkung von Nervenzellverbindungen. Das Resultat: Negative Erlebnisse brennen sich förmlich in unser Gedächtnis ein.
#3
Negative Gefühle sind dreimal stärker
Eine weitere spannende Studie der Forscherin Catherine J. Norris und ihrem Team kam zu diesem krassen Ergebnis: Negative Emotionen fast dreimal so großen Einfluss auf die Psyche wie positive. Das bedeutet, dass eine Kritik emotional etwa so schwer wiegt wie drei Komplimente! Auch Prof. John T. Cacioppo konnte in seinen Experimenten zeigen, dass das Gehirn deutlich stärker auf alles Negative reagiert. Du reagierst also wahrscheinlich heftiger, wenn dir der Bus vor der Nase wegfährt, als wenn du Geld auf der Straße findest. Diese Ungleichgewichtung sorgt dafür, dass negative Erlebnisse unser Denken und unsere Stimmung überproportional beeinflussen.
Im Video: So wirkungsvoll ist Journaling für deine Psyche
Wie und warum sich Journaling so positiv auf deine psychische Gesundheit auswirkt, erklären wir dir im Video.
Und wenn du direkt loslegen willst, können wir dir dieses 6-Minuten-Tagebuch sehr ans Herz legen:
#4
Der Kontext geht verloren
Forscher*innen fanden ebenfalls heraus, dass negative Erlebnisse oft ohne Kontext abgespeichert werden. Während die Amygdala bei negativen Bildern auf Hochtouren läuft, nimmt gleichzeitig die Aktivität in jenen Bereichen ab, die für das Abspeichern des Kontextes verantwortlich sind. Das erklärt, warum wir uns an den heftigen Streit erinnern, aber nicht mehr daran, wie es überhaupt dazu kam. Diese Diskrepanz kann die Entstehung psychischer Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörungen erklären: Ohne den richtigen Kontext können traumatische Erlebnisse nicht eingeordnet werden.
#5
Das Gehirn ist grundsätzlich auf „Schwarzmalerei“ gepolt
Neurowissenschaftlerin Kay Tye vom Salk Institute entdeckte, dass das Gehirn im Grundzustand sozusagen auf Schwarzmalerei gepolt ist: Erinnerungen erhalten automatisch eine negative Konnotation. Erst wenn das Neuropeptid Neurotensin ins Spiel kommt, können sie stattdessen mit Positivem assoziiert werden. In Experimenten mit Mäusen zeigte sich: Konnten die Tiere kein Neurotensin mehr ausschütten, gelang es ihnen nicht mehr, positive Erinnerungen abzuspeichern – an Negatives erinnerten sie sich dafür umso besser.
Ratschlag:
So kannst du dem Negativitätsbias entgegenwirken
Der Negativitätsbias ist zwar tief in uns verwurzelt, aber wir können ihm entgegenwirken. Autor Neil Pasrichas empfiehlt eine simple 2-Minuten-Morgenroutine: Schreib jeden Tag auf, wofür du dankbar bist. Studien belegen bereits, dass erhöhte Dankbarkeit zu mehr Zufriedenheit führt und sogar das Risiko für Depressionen, Suchterkrankungen oder Burn-Out reduzieren kann. Du kannst auch bewusst positive Erlebnisse „verstärken“, indem du sie aufschreibst, darüber nachdenkst oder mit anderen darüber sprichst. Wichtig ist zu verstehen: Es braucht etwa vier positive Erlebnisse, um ein negatives auszugleichen. Sei also geduldig mit dir und erkenne den Negativitätsbias als das, was er ist: ein steinzeitliches Schutzprogramm, das in der modernen Welt oft mehr schadet, als nützt.
Schutzmechanismen, die früher geholfen haben – dich heute aber sabotieren
Unser Gehirn ist manchmal schon komisch … Doch zu wissen, was „da oben“ vor sich geht, hilft ungemein! So ist es auch mit diesen Strategien, die als Kind dein Schutzschild waren, doch heute dringen abgelegt werden sollten.